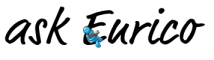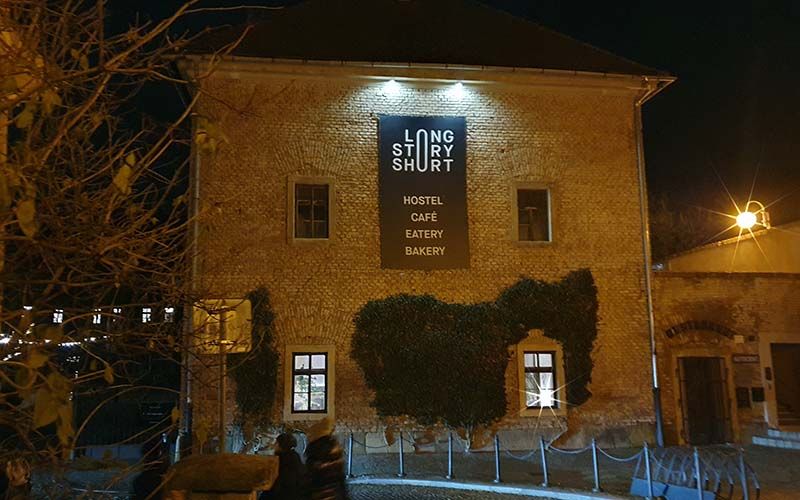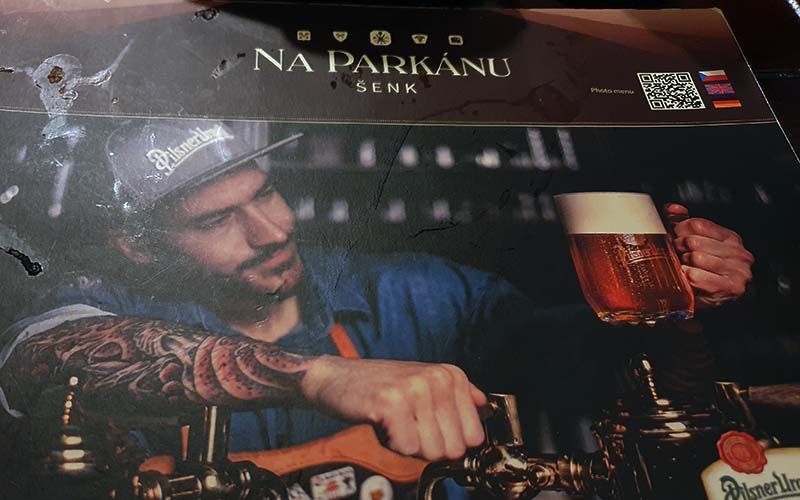Třebič hat eine lange wechselhafte Geschichte. Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1101.
Brachte ihre hervorragende Lage zwischen den Königsstädten Brno, Jilhava und Znojmo anfangs Vorteile, wurde die Stadt später immer wieder in kriegerische Auseinandersetzungen hineingezogen und verwüstet. Brände wüteten und die Bevölkerung litt unter Seuchen. Heute beeindruckt die Stadt durch ihre vielen Sehenswürdigkeiten: die Basilika des Hl. Prokops und das jüdische Viertel stehen auf der Liste des UNESCO Weltkulturerbes.
Geschichte
1101 gründen die Fürsten aus dem mährischen Zweig der Přemislyden (Oldřich Brněnský – Ulrich von Brünn und Litold Znojemský – Litold von Znaim) hier ein Benediktinerkloster, um das sich eine mittelalterliche Stadt an beiden Seiten des Flusses Jilhava entwickelt. Durch die Großzügigkeit der Fürsten gehört das Kloster zu den reichsten im ganzen Königreich und wird ein bedeutendes Bildungszentrum. Die älteste erhaltene Urkunde stammt aus dem Jahre 1277.

Der Abt Martin erzählt über die Verdienst von Herman in Třebíč, der als Gründer der Stadt angesehen werden kann. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts (möglicherweise zwischen 1240 und 1260) beginnt der Bau der Basilika im romanisch-gotischem Stil. Diese wird zuerst der Jungfrau Maria geweiht, später dem Hl. Prokop. 1335 wird Třebíč vom späteren Kaiser Karl IV. und seinem Vater, dem tschechischen König Jan Lucembursky zur Stadt erhoben und der Bau einer Stadtmauer genehmigt, deren Reste heute noch erhalten sind. Diese schützte die Stadt bis ins 18. Jahrhundert, dann verlor sie an Bedeutung und hinderte die Stadt eher bei ihrer Ausdehnung.

Obwohl Třebíč nicht den Status einer königlichen Stadt erhält, steht sie von nun an unter königlichen Schutz und kann so Entscheidungen freier, ohne Abhängigkeit vom Kloster, treffen. Bereits 1338 wird das Jugendviertel von Třebíč erstmals erwähnt. In 1468 – während der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Jiří Podiebrad und Matthias Covinus (Hussitenkriege) wird die Stadt fast völlig vernichtet und verliert damit ihr gotischen Aussehen. Matthias Covinus sendet einen stolzen Brief über den Sieg an die Katholiken: „… Třebíč wurde eingenommen, zerstört und bis auf den Grund niedergebrannt.“ Die Stadt war damit aus der Landkarte gelöscht.

Sieben Jahre lang – glaubt man den Chroniken – bestand sie nur aus Ruinen. Über die nächsten zwanzig Jahre gibt es nur spärliche Aufzeichnungen. 1483 findet der Tschechische König Vladislav Zuflucht während einer Seuchenepidemie und gewährt dadurch den tschechischen Adeligen einige Privilegien. 1490 verpachtet König Vladislav das Kloster an Vilem von Pernstejn, die Pacht geht 1556 in einen Erbbesitz der Pernstejns über. Dazwischen – in 1525 überträgt Jan von Pernstejn den Besitz an Arkleb Cernohorsky von Boskovice, der dafür sorgt, dass die Verwaltung der Stadt von den Mönchen in eine feudale säkulare Administration übergeht.

Da in der Stadt später immer wieder schwere Brände ausbrechen, sind nur wenige Renaissance-Bauten erhalten. Die Bedeutung der Stadt zeigt sich am Karlsplatz, der mit seiner Fläche von 22.000m2 einen guten Eindruck darin bietet.
Die Blütezeiten der Stadt wechseln sich immer wieder mit Stillstand und Verfall ab. Vor der Schlacht am Weißen Berg sympathisiert Třebíč mit der religiösen Gemeinschaft der „Mährischen Brüder“ (jednota bratrská), die jedoch während des Dreißigjährigen Krieges fast vollständig vernichtet wird. Třebič jedoch übersteht den Krieg relativ unbeschädigt und wehrt sich auch lange Zeit gegen eine neuerliche Katholisierung. Die Stadt kommt ab dieser Zeit bis zur Enteignung 1945 im Besitz der Waldsteins.

1614 verläßt Katharina von Waldstein aus religiösen Gründen Třebíč und übergibt die Besitztümer an ihren Bruder Adam. In ihrem Testament ordnet sie an, dass der Besitz immer an den ältesten Sohn weitergegeben wird und bestimmt das Erbe als unteilbar, außerdem dürfen die Besitzungen weder veräußert noch belastet werden. Dieses Erbrecht bringt die lange Herrschaft der Waldsteins über das Gebiet.

Etwas später, nach der Übernahme der Waldsteins, bauen die Katholiken als Zeichen des Sieges das Kapuziner-Kloster in Jejkov, das früher das Zentrum der Mährischen Bruderschaft war und eine Kapelle, ein Spital und einen Friedhof der Brüderschaft beherbergt hatte. Das Kloster und die Kirche im einfachen Stil der Kapuziner wird 1693 an der Stelle der früheren Kapelle der Brüderschaft vollendet. 1619 übernachtet Friedrich V., als Friedrich I. böhmischer König (genannt der Winterkönig, da er nur ein Jahr regiert) in Třebíč.

Das 18. Jahrhundert bringt viele Auseinandersetzungen mit dem Geschlecht der Waldsteins, am Häufigsten wird mit Jan Josef von Waldstein gestritten, der die alten Privilegien der Stadt angreift und abschaffen will, was ihm allerdings nicht gelingt.
Das 19. Jahrhundert zeigt große Veränderungen: Statt der Weber und Tuchmacher steht nun die Herstellung von Schuhen und die Lederbearbeitung im Mittelpunkt. Gleich am Anfang des Jahrhunderts, 1805, steht die Stadt wieder vor einer großen ökonomischen Herausforderung während des napoleonischen Krieges: Marschall Benadotte zieht mit seiner Armee in Třebíč ein und die Stadt muss Soldaten und Pferde verpflegen. In 1830 sorgen Überschwemmungen immer wieder für Zerstörungen, dazu bricht 1832 und 1836 die Cholera aus.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigen auch hier nationale Bestrebungen Erfolg: die Tschechisch sprechende Bevölkerung setzt sich im Kampf um die politische Macht gegen die reichere deutschböhmische Minderheit durch, ein Gemeindehaus für das soziale und kulturelle Leben entsteht 1871. 1850 wird die Stadt Verwaltungszentrum und ist nun Sitz der neu errichteten Bezirkshauptmannschaften. Der Schuh- und Ledererzeugung findet auf Grund ihrer Qualität internationale Beachtung und kann sogar eine Bronze Medaille gewinnen. 1886 wird die Stadt an das Bahnnetz angeschlossen.

1931 kauft Tomas Bata eine der vier herausragenden Schuherzeugungsfirmen (Budischowski). Der Zweite Weltkrieg und hier vor allem die Jahre 39-45 vernichten nahezu die gesamte jüdische Gemeinde von Třebíč. Zwischen dem 18 und 19.Mai 1942 ordnen die deutschen Besatzer die Deportation von 281 Juden ins Konzentrationslager nach Terezin an. Nur 10 Personen kommen nach 1945 in die Stadt zurück.

Auch heute ist die Schuhherstellung, neben dem Maschinenbau, der Holzverarbeitung, sowie dem Bau von Kernkraftwerksanlagen und -ausrüstungen, immer noch ein wirtschaftlicher Schwerpunkt in Třebíč. Seit der Samtenen Revolution wurde viel in den Wiederaufbau und die Renovierung der Stadt investiert, die sich heute wieder lebendig im neuen Look präsentiert ohne die Schätze der Vergangenheit zu vernachlässigen. Schwerpunkt einer Besichtigung sind in jedem Fall die Basilika des Hl. Prokops und das ehemalige jüdische Viertel mit der Vorderen und der Hinteren Synagoge.
Sehenswürdigkeiten
Die Basilika des Hl. Prokop
Die Abtkirche, die ursprünglich der Jungfrau Maria geweiht war, wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts als Bestandteil des 1101 gegründeten Benediktinerklosters gebaut. Im romanischen Stil mit gotischen Einflüssen gehört sie zu den schönsten erhaltenen Bauwerken des Mittelalters.

Ihre Bauweise wurde von einer Spätromanischen Bauhütte, die aus dem Südwesten Frankreichs über Burgund und den Oberrhein nach Třebíč kam, beeinflusst. Die Geschichte der Kirche ist eng mit der Benediktinerabtei verknüpft - in ihrem Grundriss ist sie eine typische Klosterkirche. Sie besteht aus drei Teilen: ein Teil für das Volk, der mittlere Teil der Kirche war den Mönchen vorbehalten und im dritten Teil der Apsis, wurde die Messe zelebriert.

Während des böhmisch-ungarischen Krieges in 1468 wird auch die Kirche schwer beschädigt – sogar die Decke stürzt ein – und da die Besitzer in der Folge rasch wechseln, wird sie mehr als zwei Jahrhunderte für weltliche Zwecke benutzt. Sie dient unter anderem als Getreidekammer, Pferdestall und als Sudhaus einer Bierbrauerei. 1629 gelangt die Kirche und das Kloster in den Besitz der Familie Waldstein, die das Kloster in ein Renaissanceschloss umbauen lassen.

Das Anwesen bleibt in ihrem Besitz bis zur Enteignung 1945. Um 1704 ordnet Jan Karel von Waldstein die Umwandlung des Presbyteriums in eine Schlosskapelle an, die dem Hl. Prokop geweiht wird. Rote Kreuze an den Wänden bei der Statue des Hl.Prokop werden anläßlich dieser Weihe vom Bischof angebracht. Der Hl. Prokop ist einer der Schutzheiligen Tschechiens und war der erste böhmische Heilige, der in Rom heilig gesprochen wurde.

Neben dem Hl. Prokop ist der Teufel zu sehen - die Statuenkombination symbolisiert den Sieg des Guten über das Böse. Erst zwischen 1725 und 1731 wird mit dem Wiederaufbau der Basilika unter der Herrschaft von Jan Josef Waldstein begonnen. Der Architekt F. M. Kaňka leitet die Renovierungsarbeiten. Er entfernt die alten baufällig gewordenen Gewölbe und ersetzt sie durch barockes Netzgewölbe. Zu dieser Zeit werden auch die beiden Türmer im Stil der barocken Gotik gebaut. Nach dem Wiederaufbau wird die Kirche erneut für sakrale Zwecke genutzt.

Man betritt die Basilika durch das sogenannte Paradiestor aus Sandstein, das eine Eingangshalle vor Verwitterungseinflüssen schützt. 11 Granitsäulen schmücken auf jeder Portalseite das Tor. Die Verzierungen zwischen den Säulen symbolisieren die Lobeshymnen an den Schöpfer nach dem Buch Daniels im alten Testatment. Pflanzen, Ranken, geometrische Ornamente und schließlich der Mensch.

Zu ihren wertvollsten Teilen gehören die dreischiffige Säulenkrypta, der mit einem doppelten achtteiligen steinernen Gewölbe überspannte Chor, das runde Rosettenfenster im Ostteil der Apsis, das Gewölbe des Presbyteriums mit Kreuzsteinwölbung und das nördliche Eingangsportal. Die Basilika ist 70m lang, 20m breit, 27m hoch und aus Granit, der aus der Nähe von Třebíč kam, gebaut. Eine weitere Besonderheit ist, dass die hintere Seite um ungefähr einen Meter breiter ist als die vordere, das bedeutet, dass die Wände auseinander streben.

Genaue Beobachter werden heute noch auf vielen Steinen die Marken – es gibt ungefähr 600 verschiedene - der Steinmetze erkennen können, die die Steinblöcke für die Basilika herstellten. Diese Zeichen wurden nicht für Ruhm und Ehre in den Stein gemeißelt, sondern aus einem ganz einfachen Grund: um die Bezahlung der Arbeit sicher zu stellen. Sehenswert sind im Hauptschiff auch noch die Barockstatuen, die tschechische und böhmische Heilige darstellen.

Im Chor sieht man zu beiden Seiten romanische Doppelfenster – auf der einen Seite ist auch noch die „Loge“ zu sehen, in der die adeligen Besitzer, getrennt von den übrigen Kirchenbesuchern, der Messe folgen konnten. Die roten Kreuze auf der linken und rechten Seite sind Symbole für die Weihe der Kirche an den Hl. Prokop. Rechts finden sich drei Gedenktafel, die an die früheren Besitzer, vor allem die Familie Waldstein (Wallenstein) erinnern.

Das Kreuzgewölbe der Apsis ruht auf hohen Pfeilern, deren Anzahl – 33 – an die 33 Jahre Christi erinnern sollen. Der moderne (stammt aus 1930) Altar zeigt die Heiligen Adalbert, Bischof von Prag und die slawischen Apostel Cyrill und Method. Hinter dem Altar befindet sich das romanische Rosettenfenster, als dessen Vorlage jenes aus Reims in Frankreich gilt.

In der Nordkapelle oder Abtkapelle am Ende des nördlichen Seitenschiffs beeindrucken die Fresken, die 1568 mit weißer Farbe übermalt wurden und erst 1932 wieder entdeckt wurden. Sie sind die zweitältesten Freskenmalereien in der tschechischen Republik. Am besten erhalten sind jene über dem Eingang – hier kann man sogar noch die Gesichtszüge des Hl. Prokop erkennen. Andere Darstellungen zeigen den Hl. Johann, wie er vergiftet wird, den Hl. Johannes im kochendem Öl und darunter die Heilung einer kranken Frau.

Die Krypta stammt aus dem Jahr 1220; es ist der älteste Teil der Basilika und hier wurden die Mönche bis ins 16. Jahrhundert bestattet. Im Raum finden sich 50 Säulen, deren Kapitelle alle mit unterschiedlichen Pflanzenmotiven geschmückt sind. Eine Säule rechts hinten unterscheidet sich wesentlich vom Rest: sie stammt aus der Zeit, in der die Krypta als Lager für die Brauerei diente. Um die Fässer besser einlagern zu können, wurde ein Loch in die Außenmauer geschlagen, aber eine Säule stand noch immer im Weg, sodass diese entfernt wurde. Später wurde sie wieder eingesetzt, aber das Originalmaterial fehlte.

Einige Teile der Decke der Krypta sind nicht gestrichen, um das Baumaterial des Holznetzgewölbes zu zeigen. Das Gewölbe ist über 700 Jahre alt, das Holz wurde in Kalkmilch getaucht, nimmt man es aus der Lösung wieder heraus, wird es in einem langwierigen Prozess, der 80 Jahre dauern kann, hart wie Stein. In der linken hinteren Hälfte ist ein modernes Kunstwerk ausgestellt, das Beachtung verdient.

Sehenswert ist auch die „Zwergengalerie“, ein schmaler Umgang im Ostteil der Kirche mit ihren fünfteiligen Fenstern. Die in der ersten Hälfte im frühgotischen Stil errichtete kleine Galerie zählt zu den originellsten architektonischen Elementen der Basilika und ist auch international einzigartig.
1924 bis 1934 wurde die Basilika unter der Leitung von Kamil Hilbert renoviert und erhielt damals ihr heutiges Erscheinungsbild. 1956 wurde die Rekonstruktion der zerstörten südlichen Kapelle mit der Apsis vollendet.

Die Basilika wurde 2002 zum Nationalen Kulturdenkmal erklärt und ist seit 2003 auf der Liste des UNESCO Weltkulturerbes.
Umrundet auf jedem Fall auch von außen die Basilika, so kann man am besten die Zwergengalerie und die Rosette betrachten. Außerdem bietet sich einen wunderschönen Ausblick über die Stadt und man kann den neu angelegten Kräutergarten bewundern.

Führungen durch die Basilika finden stündlich statt, die letzte Tour beginnt eine Stunde vor Ende der Besuchszeit. Am Freitag findet die letzte Führung um 14.00 Uhr statt. Das Informationsbüro bei der Basilika hat Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00Uhr und von 12.30 bis 17.00 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag von 12.30 bis 18.00 Uhr. Wir empfehlen aber in jedem Fall vorher nochmals die unten angeführte Website zu besuchen, um eventuelle Änderungen zu erfahren.

Touristisches und Infozentrum Basilika
674 01 Třebíč, Zámek 1
Tel: +420 568 610 022 und +420 777 746 982
Email:
Weitere Informationen
www.mkstrebic.cz (Deutsch, Englisch, Tschechisch)
www.trebic.cz (Englisch und Tschechisch)
Das Jüdische Viertel und der Jüdische Friedhof
Das Gelände am linken Ufer des Flusses Jilhava war bereits im Mittelalter überwiegend von jüdischen Einwohnern besiedelt. Der allmähliche Anstieg der Einwohnerzahl auf dem beengten Gebiet, das durch den Fluss und steile Felswände begrenzt ist, ließ das einzigartige Viertel entstehen. Die dichte Bebauung mit ihren verwinkelten Gässchen, kleinen Häusern, die oft eines in das andere hineinwachsen, dunklen Ecken, gewölbten Durchgängen, in Fels gehauenen Treppen und den beiden Synagogen ist einzigartig in Europa und wurde daher auch im Jahr 2003 auf die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes gesetzt. Das jüdische Viertel von Třebíč ist als einziges jüdisches Denkmal außerhalb des Gebietes des Staates Israel im UNESCO Verzeichnis eingetragen.

Durch das Viertel führt ein Lehrpfad und es werden zwei verschiedene Besichtigungstouren angeboten. Bei den einzelnen Häusern werden sehenswerte Baudetails vorgestellt: Gewölbe, steinerne Portalleibungen, eiserne plattierte Türen, geformte Schmiedegitter. Typisch für die Bauweise sind auch die schmalen winkligen Gassen mit Schwebebögen, die die Blöcke der dicht aneinander platzierten Etagenhäuser voneinander abtrennen und die öffentlich zugänglichen Passagen in den Erdgeschossen der Häuser, mit denen die Gassen quer verbunden waren. 16 Haltestellen des Lehrpfades zeigen neben den beiden Synagogen und dem jüdischen Friedhof die bedeutendsten Bauten: Einige davon wollen wir hier vorstellen.

Vom Zerotinovo Platz führen zwei Eingänge in das jüdische Viertel, wir beginnen nun mit der – näher zum Fluss liegenden Seite. Hier finden wir gleich zu Beginn ein aus dem 16. Jahrhundert stammendes Renaissancehaus (L. Pokoného 2), das am Ende des dreißigjährigen Krieges (1648) vom Juden Abraham Nováček gekauft wurde, mit einem Laubengang auf drei Steinsäulen. Das Haus fungiert auch als Tor, das das Ghetto von der christlichen Gemeinde trennte.

Nachts, samstags und sonntags und an den Feiertagen beider Religionen wurde das jüdische Viertel durch quergezogene Ketten abgesperrt. Ende der 60er Jahre des 17. Jahrhunderts führte ein gewölbter Durchgang durch diesen Häuserkomplex und so wurde das ganze Haus auch Judentor genannt. Nach einem Brand 1873 wurde das Gewölbe des Durchgangs beseitigt. Dennoch wurde das Ghetto vom christlichen Teil niemals baulich ganz getrennt. 1727 wurden zwar Separationswände gezeichnet, aber niemals gebaut.

Das Haus mit Ecklaube und Einzelsäule (L. Pokorného 5) hat ebenfalls einen Renaissancekern. Es gehört zu den ältesten im ganzen ehemaligen Ghetto. Ursprünglich ein Parterrehaus, wurde um die Mitte des 18. Jahrhunderts das Stockwerk aufgesetzt. Früher befanden sich im Erdgeschoss der meisten jüdischen Häuser die Läden und Werkstätten, die höheren Stockwerke und die Hofflügel dienten zum Wohnen.
Das Rathaus
Das Rathaus (L. Pokorného 8) mit Mansardendach war seit dem 17. Jahrhundert das Verwaltungszentrum der politisch unabhängigen jüdischen Gemeinde. Im älteren Barockkern befindet sich im Erdgeschoss ein Tonnengewölbe mit Lünetten, die historisierende Fassade wurde 1899 vom Architekten Jaroslav Herzán gestaltet. Im Erdgeschoss waren auch hier früher Geschäfte untergebracht und eine Mikwe – ein jüdische Ritualbad.

Das Haus des Rabbi
Gegenüber der Vorderen Synagoge (Alte Schule) befindet sich das Haus für den Rabbi (Tiché náměstí 4), das um die Mitte des 17. Jahrhunderts gebaut wurde. Der Baustil des Barocks ist hier durch die Gewölbe in den Innenräumen und robuste Stützpfeiler vertreten. Im Erdgeschoss war angeblich früher eine Matzebäckerei beheimatet.

Der erste Rabbiner der jüdischen Gemeinde war Aron Nepole, wie schriftliche Aufzeichnungen vom Ende des 16. Jahrhunderts belegen. Unter dem Rabbi Joachim Josef Pollak gab es um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine bedeutende Rabbinerschule in Třebič.
Die Vordere Synagoge
Die Vordere Synagoge - auch Alte Schule genannt - am Tiché náměstí wurde in den Jahren 1639 bis 1642 anstelle einer älteren heiligen Stätte, die aus Holz bestand, gebaut. Der große Saal des Gebäudes zeichnet sich durch ein Muldengewölbe aus. Die Synagoge hatte 114 Plätze für die Männer im Saal und 80 Plätze für die Frauen auf der Galerie, die die Frauen über einen eigenen Seiteneingang betreten mussten. Sie wurde oft umgebaut und eine Geschichte besagt sogar, dass sie 1757 um einen Stock verkleinert werden musste, da das Gebäude damals alle umliegenden Häuser überragte, sodass die festliche Beleuchtung des Innenraumes weithin zu sehen war und die damalige Besitzerin des Schlosses – Katarina von Wallenstein – störte.

Nach einigen Bränden und weiteren Umbauten erhielt sie schließlich 1856-1857 ihr heutiges neugotisches Aussehen. Auch in 1880 und 1922 wurden einige Umbauten durchgeführt. Während des Zweiten Weltkrieges wurde sie von den Deutschen Truppen beschädigt und als Lagerhaus benutzt und stark zerstört. Im Vestibül wurde nach dem Krieg ein metallischer Behälter mit einer Gedenktafel eingemauert, die die Geschichte der Synagoge erzählt und ein Verzeichnis der Namen aller Třebičer Holocaustopfer aufzählt. 1952 wurde der einfache viereckige Bau mit dem Walmdach und den gotischen Fenstern mit Spitzbogen an die Tschechoslowakische Hussitenkirche verkauft, die die Räume für ihre Gottesdienste anpassten.
Das Haus von Leopold Pokorny
Das gut erhaltene Haus in der L. Pokorného 25 gibt einen guten Einblick in die Bebauung des jüdischen Viertels. Das Gebäude zeichnet sich durch einen Barockkern, einen Balkon auf Kragsteinen und eine Empire-Fassade mit Pilastern, Palmettendekor und Figuralmotiven aus. Interessant sind die beschlagene Tür zur Werkstatt im Erdgeschoss und die Portalsteinumrahmungen mit den Aussparungen.

In diese wurden Bretter geschoben, um damit vor Hochwasser geschützt zu sein. In diesem Haus wohnte der Legionär Leopold Pokorny, nach ihm ist auch die Straße benannt. Beachtenswert ist auch das Hausschild 53 abc – das bedeutet, dass das Haus im Besitz dreier verschiedener Herren stand.
Subaks Gerberei
Wenige Schritte von der Hinteren Synagoge entfernt, sieht man noch den hohen Schlot der Gerberei. Vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zu den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts befand sich in dem allmählich entstandenen Gebäudekomplex die Gerberei der Familie Subak.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich aus dem kleinen Betrieb eine immer größer werdende Fabrik, die jedoch 1931 stillgelegt wurde. Später wurden die Fabriksräume teilweise zu Kleinwohnungen umgebaut.
Die Hintere Synagoge
Die Hintere Synagoge ist jünger als die vordere Synagoge, sie wurde im Jahr 1669 erbaut und in den Jahren 1705 bis 1707 im Barockstil umgebaut. Der Innenraum ist mit Stuckschmuck und Malereien verziert, für die ornamentale und pflanzliche Motive, sowie hebräische liturgische Texte verwendet wurden.

Die Beschriftungen an den Wänden sind überwiegend Gebete. Obwohl es nicht üblich war, Personen oder Tiere darzustellen findet man im Erdgeschoss die Abbildung von zwei Löwen, den Wappen der Wallensteins. Sie wurden als Dank der jüdischen Gemeinde an die Wallensteins angebracht, die die Erlaubnis zur Renovierung der Synagoge gegeben hatten. An der Decke sieht man drei Bilder, die zwischen 1705 und 1707 gemalt wurden: das Mittlere stellt einen Sonnenuntergang dar, während die beiden anderen den Nachthimmel mit Sternen zeigen.
Die stärkste Mauer befindet sich gleich links der Türe, sie weist nach Jerusalem und hier war früher die Thora in einer Wandnische untergebracht, der Vorhang ist ein Original, das noch aus früheren Zeiten stammt.

Männer und Frauen beteten getrennt: die Männer im Erdgeschoss, für die Frauen wurde die sogenannte Galerie im ersten Stock errichtet. Früher führte auch ein eigener Eingang außen an der Wand in die Frauengalerie, dieser wurde allerdings später ein Teil des benachbarten Hauses und ist daher nicht mehr erhalten. In diesem Gebäude ist nun eine Ausstellung über das damalige jüdische Leben untergebracht. Es werden verschiedene Zimmer mit ihren typischen Einrichtungsgegenständen gezeigt und im Erdgeschoss ist ein Kaufmannsladen eingerichtet. In der Frauengalerie befindet sich eine umfangreiche Ausstellung über die Geschichte des jüdischen Viertels. Die ausgestellten Gegenstände zeigen das gewöhnliche Leben der damaligen Bewohner, sowie deren Religionsgewohnheiten und Rituale.

Außerdem gibt ein Modell im Maßstab 1:100 Einblick in das Aussehen der damaligen Stadt. 3.000 Stunden waren zur Anfertigung des Modells, das zusätzlich in verschiedenen Sprachen (auch deutsch) über die Stadt und ihre Einwohner erzählt, notwendig. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Synagoge nicht mehr für religiöse Zwecke benutzt, sondern als Lagerraum: zuerst 1926 von I.H. Subak und Söhnen, dann von der Zelenina Třebíč Company. Durch die Lagerung von Gemüse, vor allem Paradeiser, wurden große Schäden am Bauwerk verursacht. Von 1987 bis 1988 stellte der Architekt Harald Čadílek Pläne zur Renovierung der Synagoge vor, die zwischen 1991 und 1992 nochmals überarbeitet wurden. Die überarbeitete Fassung nahm verstärkt Rücksicht auf die erhaltenen Kunstgegenstände von historischem Interesse, besonders auf die Wandmalereien. 1996 wurde die Fertigstellung und Wiedereröffnung gefeiert.

Heute dient die Synagoge als Ausstellungs- und Konzertsaal. 2003 wurde sie gemeinsam mit dem jüdischen Viertel auf die Weltkulturerbe-Liste der UNESCO gesetzt. Die Synagoge ist täglich für die Öffentlichkeit zugänglich. Weitere Informationen gibt es im Touristischen Informationszentrum der Hinteren Synagoge.
Touristisches Infozentrum Zadní synagoga
674 01 Třebíč, Subakova 1/44
Tel: +420 568 610 023
Email:
Das Krankenhaus
Bereits in den Anfängen des Getthos gab es ein "Krankenhaus", in dem die kranken Menschen behandelt wurden, allerdings war es zu Beginn im Gemeindehaus untergebracht. 1852 jedoch ließ die jüdische Gemeinde den zweigeschossigen Bau errichten, der damals mit den modernsten Einrichtungen und medizinischen Mitteln ausgestattet war.

281 Menschen wurden von hier während des Zweiten Weltkrieges in das Konzentrationslager Terezin (Theresienstadt) gebracht, nur 10 von ihnen kehrten nach Ende des Krieges zurück, konnten und/oder wollten aber die jüdische Gemeinde nicht mehr neu aufbauen.
Der jüdische Friedhof
Der Friedhof wurde auf einem Abhang oberhalb des Baches Týnský in den 20er Jahren des 17. Jahrhunderts angelegt. Mit seinen rund 3.000 Grabsteinen auf fast 12.000m2 zählt er zu den größten in der Tschechischen Republik.

In der Vergangenheit musste der Landesherr die Erlaubnis zur Errichtung eines Friedhofes erteilen. Das hatte zur Folge, dass die Friedhöfe oft weit entfernt der Stadt lagen, um nicht in Sichtweite für die anderen Bewohner zu sein. Die Třebícer Juden begruben ihre Verstorbenen nahe der Mauer des Benediktinerklosters. Der alte jüdische Friedhof wurde entweder 1468 beim Einfall der ungarischen Truppen zerstört oder auf Befehl von Katerina von Waldstein Anfang des 17. Jahrhunderts. Der neue Friedhof wurde auf einem Hang des Hradek Hügels über dem Tynsky Bach errichtet und war von einer Steinmauer umgeben. 1888 wurde er vergrößert. Bis zu 11.000 Menschen wurden hier begraben, die 3.000 Grabsteine mit unterschiedlicher ornamentaler Gestaltung zeigen die Entwicklung der Formen und Entwürfe. Da der Platz nicht ausreichte, die Grabsteine aber nicht bewegt werden sollten, wurden die Gräber in verschiedenen Lagen aufeinander platziert.

Man betritt den Friedhof über die ulice Hradek durch ein Schmiedeeisentor. Neben dem Eingang befindet sich die Begräbnishalle aus dem Jahr 1903, deren Einrichtung und Verzierungen nahezu vollständig erhalten geblieben sind. Eines der wertvollsten Stücke ist eine verzierte Waschschüssel aus Porzellan, die für die rituelle Handwaschung vor der Zeremonie Verwendung fand. Außerdem befinden sich noch zwei Steinboxen für Spenden beim Eingang. Im nördlichen, ältesten Teil des Friedhofs können wir Grabsteine aus der Renaissance finden, die vom alten, geschlossenen Friedhof hierher gebracht wurden. Sie zeigen ornamentale Beschreibungen in Hebräisch, die Namen auf den Steinen sind meistens in Tschechisch. Die modernen Grabsteine sind meistens größer, länglich und manche haben die Form eines Obelisken. Ihre Inschriften sind meistens in Deutsch und kaum verziert. Der Friedhof gehört zu den wertvollsten und am besten erhaltendsten in ganz Mähren. Er ist frei zugänglich, Besichtigungen können mit einem Führer können vereinbart werden.
Der Stadtturm
Der Stadtturm der St. Martinskirche wurde ursprünglich als ein Teil der Stadtmauern errichtet. Das genaue Datum seines Baus ist nicht bekannt, aber es wird kurz nach 1335 vermutet, nachdem Markgraf Karl Třebíč die Stadtrechte und damit die Erlaubnis zum Bau einer Stadtmauer gewährte. Die ersten schriftlichen Erwähnungen des Turms finden sich im frühen 15. Jahrhundert. 1468, beim Einfall der ungarischen Truppen wird der obere Teil des Turmes zerstört. Ursprünglich versuchten die Ungarn den Turm zu untergraben und ihn so zum Einsturz zu bringen, was aber misslang.

Ursprünglich war der Turm von der Martinskirche separiert, in 1716 wurden beide Gebäude verbunden. In den nachfolgenden Jahren wurde der Turm oftmals durch Stürme oder Brände beschädigt, dadurch veränderte er sich in seinem Aussehen. 1822, als ein Brand fast die Hälfte der Stadt zerstörte, wurde auch der Stadtturm stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Teil oberhalb der Galerie drohte zusammenzubrechen – da das Geld fehlte, wurde nur mehr ein pyramidenförmiges Dach aufgesetzt. 1862 – bei einer neuerlichen Restaurierung bekam der Stadtturm das heutige Aussehen obwohl noch einige Ausbesserungen folgten. Die letzte größere Wiederherstellung ist aus den Jahren 1996-1997.

Der Turmrundgang befindet sich in 35m Höhe und bietet einen wundervollen Ausblick über die ganze Stadt. Die Höhe des Turms beträgt 75 Meter. Erwähnenswert ist auch die Turmuhr, die zu den größten, wenn nicht überhaupt die größte Turmuhr Europas ist: Das Ziffernblatt hat einen Durchmesser von 550cm, die Größe der Ziffern ist 60 cm.
Weitere Informationen
Martinské náměsti 10,
Tel: 420 568 610 028
Außerhalb der Hauptsaison kann man hier Gruppenbesichtigungen vereinbaren:
Touristisches Infozentrum
674 01 Třebíč, Karlovo náměsti 53
Tel: +420 568 847 070
Email:
Website: www.mkstrebic.cz

Hradek Bastion
1924, zum 500sten Todestag des Heerführers Jan Žižkas, beschloss die Stadt Třebíč in Erinnerung an den Feldherrn einen Grabhügel aus Granitsteinen in „Hradek“ zu errichten. Der Grabhügel liegt in der Nähe der Ruinen der mittelalterlichen Bastion, bei der – der Legende nach – Žižka sein Zelt aufgeschlagen hatte.
Der Karlsplatz
Der zentrale Marktplatz der Stadt unterstreicht mit seiner Fläche von etwa 22.000m2, umsäumt von zahlreichen Barock- und Renaissancehäusern, die einstige Bedeutung der Stadt. Noch am Anfang des 19. Jahrhunderts beeindruckte der Platz mit seinen vielen Renaissance und Barockgiebeln von denen leider viele bei einem Brand 1822 zum Opfer fielen. Leider wurden in der 2.Hälfte des 19. Jahrhunderts auch die Stadttore zerstört, sodass der Platz viel von seiner malerischen Erscheinung verloren hat. In der Mitte des Platzes finden sich die Skulpturen von Cyrill und Method, die nach den Plänen von L. Simek der Bildhauer B. Seeling 1885 erschaffen hat.

Das bemalte Haus (Frantiskovský dum)
Das Sgraffitohaus am Karlsplatz 53 wurde im späten 16. Jahrhundert vom venezianischen Kaufmann Franceso Calligardi erbaut, der es als Geschäft für den Verkauf seiner Kolonialwaren nutzte. Aus dem Namen des Besitzers Franceso wurde bald Frantisek und so wurde das Gebäude als Františkovský bekannt. Spätere Besitzer ließen die Sgraffitomalerein mit Kalk weiß übertünchen, sodass sie erst wieder 1903 von Josef Kozlansky, einem Lehrer am hiesigen Gymnasium entdeckt wurden. Unter dem Sims gibt es mehrere Zeichnungen eines Jägers und eines Löwen, zwischen den einzelnen Fenstern werden biblische Figuren dargestellt. Unterhalb der Erkerfenster finden sich Bilder eines Mannes im typischen Gewand des 16. Jahrhunderts, die Fassade zur Hasskova ulica zeigt Männer mit einer Jagdausrüstung, eingerahmt mit verschiedener ornamentaler Dekoration. 1980 wurde das Gebäude generalüberholt, da sich bereits einige Steine von den Wänden zu lösen begannen und das ganze Haus unstabil wurde. Dabei wurde nicht nur die Inneneinrichtung überholt, auch die Sgraffitozeichnungen wurden gereinigt. Der erste Stock wurde als Ausstellungsraum adaptiert, im Mittelgeschoss finden Veranstaltungen statt, ein Radio Studio und ein Verlag befinden im obersten Stockwerk und auch das Informationszentrum hat hier seinen Sitz.
Weitere Informationen
Karlovo náměstí 53
Tel: +420 568 847 070
Email:
www.mkstrebic.cz

Das schwarze Haus (Rabluv dum)
In der Mitte der unteren Seite des Karlsplatzes befindet sich das Haus von Jan Ráb, einem Seifenhersteller, der bei der Renovierung des Gebäudes feststellte, dass die Fassade, die auf den Karlsplatz zeigt, mit Graffito Figuren verziert war. Die oberen Stockwerke des Gebäudes sind mit Figuren, die die menschlichen Tugenden darstellen verziert: Glaube, Liebe, Hoffnung, Gerechtigkeit, Vernunft und Ruhm. Die unteren Stockwerke zeigen Jagdmotive mit Vespasian und Titus, den zwei römischen Kaisern. Auch bei diesem Haus wurde Mitte des 19. Jahrhunderts das Sgraffito übermalt und leider wurde es 1927 nicht ganz professionell wieder hergestellt. Ein wahres Meisterstück stellt das Portal des Hauses dar, über dem folgender Satz in alter tschechischer Sprache steht: "POZIEHNEG HOSPODINE TOMUTO DOMU Y WSSECHNIEM W NIEM PRZEBYWAGYCZYM." (Gott beschütze dieses Haus und alle die darin wohnen).

Die Windmühle
Sie stellt ein ungewöhnliches dominierendes Element des südwestlichen Stadtteils von Třebíč dar: die Windmühle holländischen Typs, erbaut 1836. Die Windmühle, besser bekannt als „vetrnik“ – dem umgangssprachlichen tschechischen Wort für Windmühle - steht nahe der Bahnstrecke, die Jilhava und Brno verbindet. Die Bewohner nennen den Platz „Kanciborek“ in der U vetrniku Straße, ein Steinwurf von der Innenstadt entfernt. Trotz Protesten der damaligen Bewohner, die fürchteten, dass die Segel der Windmühle die Pferdegespanne verschrecken könnte, wurde die Windmühle von den Brüdern Karel und Frantisek Budisowsky gebaut und 1836 vollendet.

Ursprünglich war als Baumaterial Holz vorgesehen, aber da in diesem Fall ein Brand schnell auf die Nachbarhäuser übergreifen konnte, wurde beschlossen sie doch aus Stein und Ziegel zu bauen. Die Mühle diente damals nicht zum Mahlen von Getreide, sondern sie mahlte für hiesige Lohngerber. Die Mühle zerkleinerte Eichenrinde bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, dann wurde sie von Dampfmaschinen abgelöst. Anschließend wurde versucht, sie als Wohnhaus zu nutzen, was aber durch die räumliche Gestaltung nicht optimal war. 1977 zogen die letzten Mieter aus, die Außenfront der Mühle wurde renoviert und sie ist seither nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich.
Heute stellt die Windmühle ein einzigartiges Wahrzeichen dar und soll als eine technische Rarität erhalten bleiben.
Das Waldsteinschloss (das ehemalige Kloster)
Das an dieser Stelle ursprünglich errichtete Kloster wurde seit der Gründung 1101 schrittweise ausgebaut. Zuerst in Holzbauweise errichtet, wurden die ersten Gebäude im Laufe der Zeit durch steinerne Mauern ersetzt. In den 30er bis 70er Jahren des 13.Jahrhunderts erfolgte ein umfassender Umbau, bei dem das Kloster befestigt wurde.

Bis auf die Kirche wurden alle Klostergebäude nach dem Untergang des Klosters in das neu gebaute Schloss eingegliedert. Zum Schloss wurden vor allem die zur südlichen Seite anliegenden Gebäude der Klausur umgebaut. Hier befanden sich das Dormitorium, der gemeinsame Schlafraum der Mönche, die Schreibstube, der Speise- und Kapitelsaal, sowie der Umkleideraum. Zu den geschlossenen Klosterräumlichkeiten gehörte auch Küche, Backstube, Brauhaus, Lagerräume für Lebensmittel und Getränke und ein Gefängnis. Diese Gebäude umschließen den sogenannten Paradieshof – den heutigen Innenhof des Schlosses, auf dem früher ein Brunnen oder eine Quelle ihren Platz hatte. Außerhalb der Klausur nordwärts war der Sitz des Abtes, die Unterkunft für Novizen und das Quartier der alten und kranken Mönche.

Im westlichen Teil des Geländes war das Gesinde untergebracht und es wurde als Wirtschaftsgebäude genutzt. Nach dem Umbau des Klostergebäudes zum Schloss blieb der Zweck der Gebäude weitgehend unverändert.
Unter der Herrschaft Smil Osovský von Doubravice wurde das Gebäude zum Renaissanceschloss umgebaut und die ehemalige Klosterklausur um ein Stockwerk erhöht. Außerdem wurde der südwestliche Flügel angebaut, der für Wohnungen genutzt wurde. Wahrscheinlich wurde unter der Regierungszeit des Hauses Osovský auch ein neuer Eingang in das Schloss auf der nördlichen Seite errichtet. Im inneren Schlosshof kann man noch Grabsteine derer von Osovkýs sehen.
Weitere bauliche Veränderungen wurden erst wieder unter den Waldsteins vorgenommen. František Augustin von Waldstein (1666 – 1684) begann mit der barocken Umgestaltung, allerdings zogen sich die Bauarbeiten bis in die 20er Jahre des 18. Jahrhunderts hin. Später wurden Veränderungen im Neu-Renaissance Stil vorgenommen, wie an dem prismenförmigen Eingangsturm ersichtlich ist. In den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde das Schloss Restaurierungsarbeiten unterzogen, 1944 bekam es seine gegenwärtige Form mit der Sgraffitorustika auf der Stirnwand des spätgotischen Tores. Das Schloss befand sich im Besitz der Herren von Waldstein-Wartenberg, bis es nach dem Zweiten Weltkrieg konfisziert wurde und heute das städtische Museum, das Museum von Vysočina beherbergt.

Das Waldsteinschloss, heute Sitz des regionalen Museums Vysočina – Třebíč, wurde im 16. Jahrhundert auf den Ruinen des weiträumigen Benediktinerklosters errichtet. Die Ausstellungen dokumentieren die Naturschönheiten in der Umgebung der Stadt, die historische Entwicklung der Besiedlung und der Handwerke in Třebíč, die Entwicklung der Tabakindustrie und die Tradition des Krippenbaus. Ein Teil der mineralogischen Ausstellung ist dem Třebíčer Moldavit gewidmet. Die ständige Ausstellung wird im Laufe des Jahres immer durch aktuelle Ausstellungen in den Räumen der ehemaligen höfischen Pferdeställe, der Kapelle und der kleinen Galerie ergänzt. Der Steinsaal mit reicher Wappenverzierung wird für Konzerte der klassischen Musik, Vorträge und Kulturveranstaltungen genutzt.
Interessante Links
Muzeum Vysočiny Třebíč
674 01 Třebíč, Zámek 1
Tel: +420 568 840 518
Email:
www.zamek-trebic.cz (Tschechisch)