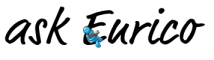Das Drama einer Familie im heutigen Iran, deren alte Männer die Religion als Machtinstrument zur Unterdrückung und Verfolgung der eigenen Landsleute missbrauchen. Einfach erschütternd. (Foto © Films Boutique/Alamode Film)
Der Beginn des Films des iranischen Regisseurs Mohammad Rasulof suggeriert familiäre Idylle gepaart mit Gesten islamischen Glaubenslebens. Der Jurist Iman (Missagh Zareh) lebt mit seiner Ehefrau Najmeh (Soheila Golestani) und den gemeinsamen Töchtern, der Studentin Rezvan (Mahsa Rostami) und der Schülerin Sana (Setareh Maleki) in Teheran. Er bedankt sich zunächst für das vermeintliche Glück der Beförderung auf den Posten eines Ermittlungsrichters am Revolutionsgericht. Ein höheres Gehalt und eine größere Wohnung vermehren auch das Ansehen. Grund genug für ein Dankesgebet in der Moschee: Gepriesen sei Gott.

Das Unglück des Ermittlungsrichters
Doch das Glück verwandelt sich allzu schnell und mit gebotener Gewalt und Grausamkeit in einen beruflichen und familiären Alptraum. Denn ein Ermittlungsrichter am Revolutionsgericht ist ein Handlanger, ein Vollstrecker. Die Anklagen der Staatsanwaltschaft dulden keinen Widerspruch – und schon gar keine Ermittlungen über das wahre oder tatsächliche Geschehen. Ein Todesurteil ist und bleibt ein Todesurteil. Mit Unterschrift des „Ermittlungsrichters“ Iman. Und allzu schnell lässt sich auch ein Delikt namens „Gotteslästerung“ zur Anklage und zur Verurteilung missliebiger Bürger missbrauchen.
Beklemmende Realität
Eigebettet in die Aufnahmen realer landesweiter politischen Proteste ab 2022 und echter brutaler Internetvideos von Demonstranten bekommt der Film eine beklemmende Realität. Er erneuert die Gewissheit, welch ein Glück es ist in einem freien demokratischen Staat und in einer freien Gesellschaft zu leben, die unterschiedliche politische Strömungen und Richtungen auszutarieren vermag und wo Religion und Staat getrennt sind.
Es gab erschwerte Drehbedingungen für die mittlerweile zehnte Regiearbeit von Mohammad Rasulof (darunter „Doch das Böse gibt es nicht“) samt Verfolgung und Verhaftung und erneuter Verurteilung zu Peitschenhieben und Gefängnisstrafe noch während der Dreharbeiten. Schließlich flüchtete er aus seinem Land.
Tödliche Umarmung
Der Titel des Films beruht übrigens auf dem Bestreben einer Feigenart, die sich ausbreitet, indem sie Bäume förmlich umschlingt und mit dieser eisernen „Umarmung“ schließlich erwürgt. Eine Vorgangsweise, der sich letztlich auch der Richter Iman im Soge seiner Tätigkeit nicht entziehen kann. Es hilft kein Wegschauen, kein Schönreden und kein Verleugnen der Mechanismen eines unbarmherzigen Gottesstaates. Dafür sorgen auch die beiden Töchter, die aussprechen, was sie sehen und was sie wahrnehmen -und die versuchen einer betroffenen Freundin, deren Gesicht im Tumult einer Straßenszene zerschossen wird, zu helfen.

Verborgene Filmaufnahmen
Die Dreharbeiten zum Film fanden im Verborgenen statt und dauerten ungefähr 70 Tage. Das Filmmaterial wurde aus dem Iran nach Deutschland geschmuggelt. So gesehen steht die inhaltliche Relevanz des Filmes an erster Stelle und erklärt auch gewisse Längen und Unebenheiten im Darstellungsverlauf, wo die meisten Filmeinstellungen in Innenräumen gedreht wurden.
Die Weltpremiere der internationalen Koproduktion zwischen dem Iran, Deutschland und Frankreich erfolgte im Hauptwettbewerb der 77. Filmfestspiele in Cannes, wo der Film mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet wurde. Im August 2024 wurde „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ als deutscher Beitrag für die Kategorie „Bester Internationaler Film“ der Oscarverleihung 2025 ausgewählt.
Regie und Drehbuch: Mohammad Rasulof
Mitwirkende: Missagh Zareh (Iman), Soheila Golestani (Najmeh), Mahsa Rostami (Rezvan), Setareh Maleki (Sana)
Schnitt: Andrew Bird
Originalsprache: Farsi